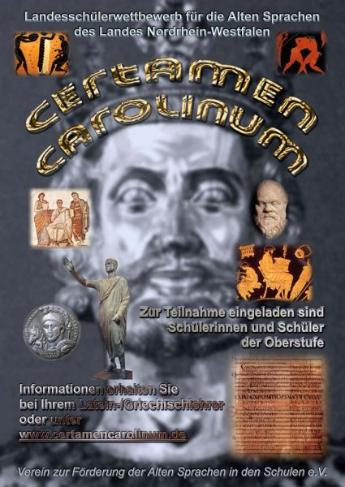Latein - die Basissprache schlechthin
Latein ist die Sprache der Römer; sie wurde über Jahrhunderte hinweg in allen Teilen des Imperium Romanum von Nordafrika bis in das heutige Großbritannien hinein gesprochen. In ihr wurden Verträge und Gesetze niedergeschrieben, Reden gehalten und bedeutende literarische Werke verfasst.
Auch nach dem Ende des römischen Reiches behielt die lateinische Sprache in Europa und anderen Teilen der Welt bis in die Neuzeit hinein als Sprache der Kirche, der Wissenschaft, der Verwaltung und des Rechts große Bedeutung. In den romanischen Sprachen, die sich kontinuierlich aus dem Lateinischen weiterentwickelt haben, sowie im Deutschen, Englischen und anderen europäischen Sprachen, die eine Vielzahl von Einzelelementen entlehnt haben, lebt die lateinische Sprache noch heute fort. Zahlreiche Fremdwörter und die wissenschaftliche Begrifflichkeit haben ihren Ursprung im Lateinischen. Insofern gilt Latein als Basissprache Europas.
Lateinische Texte eröffnen den Zugang zu einer in der Vergangenheit liegenden und in der Gegenwart wirksamen Welt. Sie befassen sich mit den jeweiligen Lebensbedingungen, mit gesellschaftlichen, politischen, kulturellen, religiösen und philosophischen Themen, mit menschlichen Erfahrungen und Schicksalen, mit Werten und Normen des Handelns. Sie spiegeln sowohl historisch und subjektiv bedingte Sichtweisen als auch Reflexionen und Erkenntnisse, die normative Kraft entfaltet und unsere Geisteswelt geprägt haben.
In einer zweieinhalbtausend Jahre langen Überlieferung von der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit liegen lateinische Texte vor, an denen sich die Entwicklung zentraler Ideen verfolgen lässt. Ob es um grundsätzliche Fragehaltungen in der Wissenschaft, um Auffassungen vom Staatswesen, um verallgemeinerungsfähige Rechtsgrundsätze, um künstlerische Motive oder um das Wesen des Menschen, seine Würde und seine Verantwortung geht, in diesen und vielen anderen Bereichen lassen sich in der Antike die gemeinsamen Wurzeln und das kulturelle europäische Erbe entdecken, das von besonderer Bedeutung für die Identitätsbildung eines zusammenwachsenden Europas ist.
Eine zentrale Aufgabe des Lateinunterrichts und komplementär zum Unterricht in den modernen Fremdsprachen ist vor diesem Hintergrund die Befähigung der Schülerinnen und Schüler zur historischen Kommunikation. Unter Nutzung kognitiver und affektiver Zugangsmöglichkeiten treten die Schülerinnen und Schüler in einen Dialog mit dem lateinischen Text und erschließen seine Mitteilung. Sie setzen sich mit den vorgefundenen Aussagen und Fragestellungen auseinander, stellen Beziehungen her zu ihrer eigenen Zeit und Lebenssituation und suchen nach individuellen Antworten auf die Mitteilungen des Textes. Schülerinnen und Schüler entwickeln auf diese Weise Verständnis für fremde Vorstellungen und Handlungsweisen, sie erkennen Elemente von Kontinuität und Wandel, entdecken wichtige gemeinsame Grundlagen europäischer Kultur und erhalten dadurch Unterstützung bei der persönlichen Orientierung und Selbstbestimmung in der Gegenwart und Zukunft. Damit fördert der Lateinunterricht die kulturelle und interkulturelle Kompetenz der Schülerinnen und Schüler.
Latein ist als Gegenstand des Unterrichts keine Sprache, die der unmittelbaren Verständigung dient. Als überschaubares System stellt sie ein Modell von Sprache dar, das sich aufgrund der historischen Distanz in besonderer Weise für sprachreflektierendes Arbeiten anbietet. Das Verstehen lateinischer Texte erfolgt in einem differenzierten Erschließungs- und Übersetzungsprozess. Dieser setzt sichere Kenntnisse in Lexik, Morphologie und Syntax der lateinischen Sprache, methodische Fertigkeiten und Wissen aus den Bereichen der römischen Geschichte und Kultur und der Rezeption der Antike voraus. Der Erschließungs- und Übersetzungsprozess erfordert in besonderem Maße Genauigkeit, systematisches Vorgehen, überlegtes Abwägen von Alternativen und kritisches Beurteilen von Lösungsversuchen. Durch diese Art der Sprach- und Textreflexion, die ein wesentliches und spezifisches Element des Lateinunterrichts ist, entwickeln Schülerinnen und Schüler Lesekompetenz. Sie werden durch das sprachkontrastive Arbeiten in die Lage versetzt, die deutsche Sprache differenzierter zu gebrauchen. Semantische, strukturelle und methodische Zugangsmöglichkeiten erleichtern ihnen das Verstehen und Erlernen weiterer Fremdsprachen. Sie verfügen über Methoden ökonomischen und wissenschaftspropädeutisch orientierten Arbeitens.
Die Entwicklung dieser Fähigkeiten ist notwendig, wenn Jugendliche sich zu selbstständigen Persönlichkeiten heranbilden sollen, die den Aufgaben und Herausforderungen der modernen Lebenswelt gewachsen sind und Bereitschaft zeigen, in ihr Verantwortung zu übernehmen.
(aus: Kernlehrplan Latein für das Gymnasium – Sekundarstufe I in Nordrhein-Westfalen, S. 11-12)